Ein (kleiner) Marathon durch eine (fast) heile Welt
Egg, 14. August 2025: Weit über 200 Treffer finden sich in meinem Archiv, wenn beim Titel ‹Heidi› eingegeben wird. Zugegeben, der grösste Teil davon entfällt auf Serien, aber auch ohne diese gibt es noch immer eine gute zweistellige Anzahl von Heidi-Verfilmungen. Dieser Beitrag verschafft einen Überblick über bekanntere wie weniger «geläufige» Werke, wobei ein Anspruch auf Vollständigkeit natürlich nicht «garantiert» werden kann. Dagegen werden die Plätze 1 bis 3 vergeben, für einige sicher in überraschender Weise.

1920: In 3 Minuten ist der Rollstuhl zerstört
Die älteste «gefundene» Heidi-Verfilmung dauert keine drei Minuten. In dieser Zeit erscheint Clara (hinkend, ohne Rollstuhl) bei Heidi, derweil Peter eifersüchtig wird und den Rollstuhl über die Klippe schmeisst.

Heidi, zunächst böse, erkennt die Chance für Clara. Die gefundene Kopie endet leider nach zweieinhalb Minuten, wobei die letzte (verfügbare) Tafel auf ein glückliches Ende hinweist. Heidi wurde von Magde Evans gespielt, die später in Hollywood (auch im Tonfilm) eine ordentliche Karriere hinlegte.
1937: Streng und heute (meistens) coloriert
Die erste «richtige» (Kinofilm) datiert aus dem Jahre 1937. Heidi wird vom damaligen Kinderstar Shirley Temple gespielt. Der Film war sehr erfolgreich und findet sich bis heute im Internet, leider allerdings meist in colorierter Version.

Gut und Böse sind im Film stark herausgearbeitet, vielleicht auch passend zum damaligen Zeitgeist. Die «colorierte» Fassung ist von ordentlicher Qualität (was bei vielen derart «verunstalteten» Werken meistens nicht der Fall ist). Das Original in Schwarz/Weiss erscheint mir dennoch passender, der Film wirkt dadurch nicht ganz so platt.

In den Staaten war der Film ein Erfolg, in Europa scheint dies weniger der Fall gewesen zu sein, wobei dies wohl auch mit dem damals nahenden zweiten Weltkrieg zu tun gehabt haben dürfte.
1952: Stunde Null mit Heinrich Gretler (Platz 2)
Als Inbegriff der Schweizer Heidi-Verfilmungen gilt die Version aus dem Jahre 1952. Heidi wird darin von Elsbeth Sigmund verkörpert. Im Unterschied zu Magde Evans und Shirley Temple war Elsbeth Sigmund aber nur in drei Kinderfilmen (Heidi, Heidi und Peter sowie Frühlingslied [S’Vreneli vom Eggisberg als Mundart-Version]) auf der Leinwand zu sehen.
Frau Sigmund wurde später Lehrerin, ob die (latente) Pädagogik der Heidi-Filme dabei eine Rolle spielte, ist nicht überliefert. Die Zeitlosigkeit der Heidi-Filme (siehe auch die Anmerkungen ganz am Schluss) dürfte aber doch auch daher rühren, dass Urchigkeit (Landleben) mit Bildung (Stadt) letztlich recht glücklich vereint wird.

Die Version von 1952 entstand aus der Not heraus, dass die Praesens Film AG in finanziellen Schwierigkeiten steckte und raschmöglichst einen «Kassenschlager» brauchte, um aus der Misere herauszukommen. Mit der Heidi-Verfilmung von 1952 gelang dem Regisseur Luigi Comencini ein Film, der es vermied, Heidi als klassische Heimatverfilmung aufzuführen. Beim Hineinschauen in heutiger Zeit gefällt noch immer die Spielfreude der Darsteller/innen.
Zweifelslos ist die Heidi-Verfilmung auch heute noch sehenswert. Dies umso mehr, als es seit einigen Jahren ein gute digitale restaurierte Fassung des Films gibt. Dass es in meiner Hitliste nicht für Platz 1 gereicht hat, hängt primär damit zusammen, dass «nur» das erste Heidi-Buch erzählt wird, der Rollstuhl-Sturz fehlt (korrekterweise). Dazu kommt, leider sollte die Fortsetzung von 1955 nicht so richtig gelingen (siehe unten). In diesem Sinne, gut gelungen, zum Sieg reicht es aber nicht.
1955: Farbe hilft Heidi und Peter nicht
Der Ersterfolg verlangte nach einer Fortsetzung. Und wie so oft, wenn es um Fortsetzungen geht, so fehlt es (wie hier vorliegend) an der Frische. Nicht zuletzt «angekratzt» werden muss/darf dies dem Regisseur Franz Schnyder, der sattsam für seine Blut-Geist-Bodenfilme bekannt ist und diesen Geist in den Film «hineinschleppte».

Oder sagen wir es etwas salopp, an Heidi und Peter aus dem Jahre 1955 gefällt die Farbe, mehr aber auch nicht. Einer Kritik des Schweizer Fernsehens zu damaliger Zeit zufolge (gemäss Wikipedia) sei Heidi und Peter ‹fremdenverkehrstauglich›. Dem sei aus heutiger Sicht hinzugefügt, wenn überhaupt. Ein pompöses Unwetter und ein Alp-Öhi mit Peter auf der Chilbi, nein, das kann einfach nicht gut gehen.
1974: Heidi wird Japanisch
Der Notiz halber sei angeführt, 1965 entsteht ein neuer Heidi-Film (von Werner Jacobs), anstelle Kutschen gibt es Auto-Karossen der 60er-Jahre. 1968 kehrt Heidi abermals heim (Delbert Mann). Bezeichnend darin ist, dass kein Peter den Rollstuhl stösst, er «röllelet» recht gemütlich quasi von alleine hinunter, just im Moment, als Clara laufen (lernen) möchte.
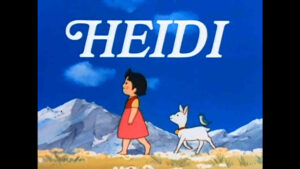
Neues Heidi-«Leben» bringt erst die japanische Trickfilm-Serie (Isao Takahata) in den 70er-Jahren. Die Qualität der Zeichnungen überzeugt über weite Strecken, auch wenn jetzt nicht immer und in letzter Konsequenz. Oder sagen wir es anders, die Liebe zu den Bergen bei den Zeichner/innen dürfte grösser gewesen sein als die Liebe zur Stadt.

Als schöpferische «Untat» taucht in der Serie ein Bernhardiner-Hund auf, dessen «Sinngabe» sich mir bis heute nicht erschliesst. Dies «schadete» dem Erfolg der Serie aber in keiner Weise. Die japanische Anime-Version machte Heidi filmtechnisch gesehen erst weltweit bekannt und berühmt.
Wie lange gewartet werden muss, bis der Rollstuhl stürzt, sei nicht verraten. Es dauert seine gute Zeit. Bei 52 Folgen dürfte dies auch nicht zu vermeiden sein.
1978: 26-Teiler mit viel Detailtreue (Platz 1)
Zugegeben, die Serie von 1978 entstand just in jenen Jahren, als ich als Kind vor dem Fernseher diese gespannt mitverfolgen konnte. Und natürlich fand ich die Heidi-Darstellerin Katia Polletin (heute Schneider) ikonisch hübsch. Doch als Bub gehört(e) es sich nicht. Fan-Poster (ich hätte ja noch nicht mal gewusst, woher es kommen sollte) im Zimmer aufzuhängen.

Aus heutiger Sicht mag ich diese Serie immer noch am meisten aller Heidi-Verfilmungen. Einmal, weil sie über 26 Folgen mit viel Liebe zum Detail auftritt. Weiter weil die Drehplätze im Oberengadin tolle Bilder hergaben (die es wohl heute so wegen Bautätigkeit kaum mehr gäbe) und weiter weil die Figuren ohne viel Pathos daherkommen. Dazu tragen auch die einfachen Kostüme bei, der Rücksprung ins 19. Jahrhundert gelingt mühelos (und ganz ohne ein gekünsteltes digitales Nachtuning).
Gemäss Katia Polletin war die Rolle ein zweischneidiges Schwert. So äusserte sie sich in einem Interview zu ihrem 50-jährigen Geburtstag dahingehend, dass die Filmarbeiten ihr zwar sehr gefallen hätten, dass aber der Rummel um ihre Person sie mit der Zeit recht genervt habe. Sie habe daher später für viele Jahre Distanz gebraucht, um ein Leben neben Heidi zu finden.

Diese Sorge hat das Publikum nicht, vielmehr lassen sich auch heute noch Dinge neu entdecken, die damals nicht auffielen. Zum Beispiel, dass Mathias Gnädinger in einigen Folgen mitwirkte, oder auch dass Anne-Marie Blanc in der ersten Folge einen kurzen Gastauftritt hat.
Geblieben ist zudem, dass noch Jahre nach der Ausstrahlung der Serie ein Streit entbrannte, ob sich das Oberengadin neben Maienfeld ebenfalls als Heidiland vermarkten dürfe. Letztlich obsiegte (touristisch gesehen) Maienfeld. Weitere Informationen zur Serie (in Französisch) gibt es auf der Fan-Seite heidiland.com. Angemerkt sei hier, gegen diese private (informative) Seite scheinen die Touristiker bis heute (zum Glück) kein Kraut gefunden zu haben.
Die Serie lässt sich nur mühsam «auftreiben», eine Kopie (4 DVDs) befindet sich in der Zentralbibliothek Zürich. Allerdings enthält diese nur die Version in Hochdeutsch. Die Mundart-Version sollte sich im Lesesaal des Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien befinden. Meine Version stammt von «Gebrauchtmarkt», dort konnte ich die gewünschte 3er-DVD-Version (mit Deutsch/Mundart) finden.
Weiter gib es eine Sprach-Version in Französisch (inkl. entsprechendem Titel-Song). Diese lässt sich aktuell über archive.org finden. Natürlich ist Platz 1 in meiner Hitliste (auch) eine subjektive Entscheidung. Die 26 Folgen bieten aber (gerade für Kinder) einen langen und vollen Genuss der Heidi-Geschichte. Hoffen wir einfach, dass sich das Fernsehen dieses Schatzes wieder einmal erinnert und eine Wiederholung ausstrahlt.
1993: Hollywood dreht in Österreich
Eineinhalb Jahrzehnte später wurde eine zweiteilige Verfilmung im Tirol, Salzburg und Kärnten gedreht. Leider wirkt das unter amerikanischer «Flagge» gedrehte Werk ziemlich platt. Die Bauten auf der Alm sehen sehr nach gebaut aus und die Kostüme wirken fade.

Typisch Hollywood stürzt Heidi die Felswand hinunter. Peter versucht sie zu retten. Clara kriecht langsam heran, und wagt keine Minute später (nach dem ersten Gehversuch) das Kunststück, sowohl Peter wie Heidi quasi aus der Felswand zu ziehen. So in einer Art Mischung aus Harry Potter und Obelix. Nur wird nicht in Ansätzen «erzählt», woher diese immense Kraft herkommt. Prädikat: Unglaublich unglaubwürdig.
2002: Imboden schafft den Spagat nicht
Im 21. Jahrhundert gibt es weitere (mir bekannte) Verfilmungen. Wenig bekannt ist die vom bekannten Regisseur Markus Imboden realisierte Version aus dem Jahre 2001/2002.

Zu Beginn des Filmes plätschert Heidi im Bergseelein, die Mutter wirkt fröhlich dazu. Später verstirbt diese tragisch, womit die Heidi-Geschichte loslegen kann. Der Versuch, modernere Themen (wie Migration) in den Film zu integrieren, scheitert daran, dass der Kontrast von Land und Stadt einfach nicht überzeugend (genug) gelingt.
2005: Klassisch britisch
Kurz nach der modernen Inszenierung von Imboden erscheint eine (nun wieder) sehr klassische Version, die unter britischer Produktion realisiert wurde. Gedreht wurde in Wales und Slowenien. Dieser «Länderbruch» wird im Film kaum aufgelöst, die Hütte steht in ebenem Gelände und ist königlich riesig, die Berge gesellen sich später dazu, wirklich stimmig wäre anders.

Immerhin ist die Szene mit dem Rollstuhl deutlich besser gelöst. Heidi rennt zwar auch unsinnig hinterher und fällt fast hinunter, gerettet wird sie aber doch (eben plausibler) vom Alp-Öhi mit kräftiger Statur.
Zwei Jahre später erscheint eine sehr simple (mit wohl wenig Budget) gedrehte Version von Edouard Maire, die nach gut einer Stunde im Wiedersehen zwischen Heidi und dem Alp-Öhi endet. Clara bleibt dabei zurück, muss also auch nicht gerettet werden, wobei der in die Tiefe fliegende Rollstuhl irgendwie doch fehlt.
2007: Heidi, 15, pflegt den Alp-Öhi
Heidi ist mittlerweile 15, sie lebt beim Öhi auf einer Alp oberhalb des Genfersees. Die Teenagerin umsorgt nun den Grossvater und muss die Landschaft vor Spekulanten retten.
Darum geht sie (etwas wenig plausibel) in die Stadt (Lausanne) zur Schule. Dort wird sie mit den Realitäten der modernen Zeiten konfrontriert. Eine Lehrerin soll gar eine Affäre mit einer Schülerin haben.
Regie führte Pierre-Antoine Hiroz, als bekannteste Persönlichkeit ist Carlos Leal (zeitweise) an Bord. Von der ursprünglichen Handlung ist wenig übrig geblieben.
Für einige Zeit erschien die Serie bei playsuisse.ch. Aktuell lässt sich diese über artfilm.ch streamen (allerdings nur in Französisch und ohne Untertitel).

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass in der Zeit zwischen 1930 und 1940 ein Charles Tritten Heidi in der Westschweiz neu auflegte. Dies tat er in derart freier Weise, dass er den beiden Büchern «Heidis Lehr- und Wanderjahre» und «Heidi kann brauchen, was es gelernt hat» (geschäftstüchtig) mehrere Bände hinzufügte.
In diesen Büchern wird Heidi erwachsen und bekommt gar Kinder. Sie übersiedelt auch in die Wstschweiz, wenn auch der Grossvater wie in dieser Serie nicht mitzügelt. Diese Bücher erreichten im französischsprachigen Raum eine weite Verbreitung. Und sie erklären vielleicht auch, warum Heidi, 15 gerade in der Westschweiz entstanden ist.
2015: Befreiung mit Gsponer und Ganz (Platz 3)
Bei der Neuverfilmung im Jahre 2015 spielt Bruno Ganz die Rolle des Öhis, er verkörpert einen zwar sturen, aber gleichwohl nicht bösen Bergmenschen. Heidi wird von Anuk Steffen verkörpert, wobei sie das gleiche Schicksal «erleidet» wie alle anderen Darstellerinnen. Anuk Steffen hat danach noch in einem Kurzfilm (Pig Heart, sehr traurig, 2019) mitgewirkt, aber ansonsten keine Karriere in der Schauspielerei angestrebt.

Die Handlung wird (wohl filmgewollt) entschlackt. Erst die Alp, dann die Stadt und dann wieder die Alp, kurz darauf auch mit Clara. Der Rollstuhl saust imposant in die Schlucht hinunter, der Öhi meint dazu etwas lapidar, das schlechte Gewissen sei Strafe genug.
Immerhin lernt Clara recht behutsam und langsam laufen, am Ende wird sie gar wieder getragen. Die Frage, warum sie weg von der Alp muss, geht etwas gar unter. Vielleicht deshalb, damit der Peter und Heidi am Schluss als Landeier in der Wiese liegen können. Immerhin galoppiert am Ende Heidi als Heldin alleine durch die Alpwiesen.

Nicht ganz perfekt sind die retuschierten Szenen gelungen, z.B. bei den Bahnaufnahmen, wo die Oberleitungen «weganimiert» wurden. Die Szene sieht sehr standhaft (im wahrsten Sinne des Wortes) aus und wirkt und auch gar kitschig. Alles in allem nach meiner Ansicht nach Platz 3 auf dem Heidi-Podest. Ich weiss schon, die meisten werden dies anders sehen.
Zum Argument, die 2015er-Version sei besser als der Gretler-Film von 1952 darf angeführt werden, dass die 1952er-Version international sehr erfolgreich war (z.B. 300 Kopien in 4000 Kinos in den USA). Sicher, die Filmlandschaft sah 1952 anders aus, aber als Low-Cost-Film (Schwarz/Weiss mit mangelhafter Synchronisation) war dies eine sehr gute Leistung. Auch erhielt der Film 1953 an der Biennale in Venedig die Auszeichnung «bester Kinderfilm». Solche Eckdaten sind von der Heidi-Version des Jahres 2015 nicht bekannt.
2015-2020: 3D-Heidi mit 65 (Un-)Folgen
Mit den neuen digitalen Möglichkeiten bei Trickfilmen musste natürlich früher oder später auch Heidi in dreidimensionaler Perspektive erscheinen. Nun denn, so erschien zwischen 2015 und 2020, was aus meiner Sicht nicht hätte erscheinen müssen.

Über satte 65 Folgen zappeln die Figuren mehr in einer mässigen Video-Game-Qualität denn der Geschichte verbunden über den Bildschirm. Der Rollstuhl fliegt in der ersten Staffel spät, aber für das Ende der Serie viel zu früh über die Klippe. Damit ist auch gesagt, die zweite Staffel erscheint sehr sehr überflüssig.

Eine harte Kritik. Nur, um beim Rollstuhl zu bleiben, so schmeisst Peter diesen nicht den Hang hinunter, weil er eifersüchtig auf Clara ist, sondern weil Heidi Clara zu ihrem Baumhaus-Versteck brachte bzw. dieses verraten habe. Das Baumhaus im übrigen ein derartiger Palast, toll wie er dies neben dem «Geissenjob» hinkriegte. Von wegen Emanzipation, der Peter ist stark und Super-Man, Heidi dagegen verrät ihn, und «nur» darum fliegt der Rollstuhl.
Und nein, dies wird auch nicht in der letzten Folge aufgelöst, als Heidi und Peter (ziemlich wirr) den Zug anhalten, um eine Telegrafenleitung zu reparieren. Der «Funkspruch» soll dazu verhelfen, dass Heidi ein Stipendium für die höhere Schule beantragen kann, um später (vielleicht mal) Lehrerin zu werden.
Warum wird der Zug jetzt angehalten? Um eine Telegrafenleitung zu reparieren, hätte doch auch eine Leiter genügt? Nun, dann könnte Peter nicht vor all den staunenden Zugspassagieren vom Wagendach zum Masten springen und unter Applaus die Leitung reparieren. So aber ist Peter der Held und Heidi ist so entzückt, dass sie «Danke Peter, Du bist der Beste» säuselt.
Die Kritiken beim Erscheinen 2015 waren gemischt. Immerhin fragten einige, ob es eine Anime-Neuauflage für die 70er-Serie brauche? Die Frage darf aus heutiger Sicht zu 100% mit Nein beantwortet werden.
2022: Heidis Alptraum (Dok-Film)
Der 2022 realisierte Dok-Film von Anita Hugi geht der Frage nach, warum Heidi derart bekannt wurde. Absolut gelungen ist der Film in der Weise, als die Schöpfer der Anime-Serie von 1974 zurück in die Schweiz kehren und (quasi) selber als Alp-Öhis über die Entstehungsgeschichte ihrer sehr erfolgreichen Serie berichten.

So erfahren wir zum Beispiel, dass die Crew vor den Arbeiten eine Studienreise in die Schweiz gemacht habe. Der Chefanimateur führte aus, dass er seinen Entwurf einem Johanna Spyri-Archivar gezeigt habe. Dieser habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass Heidi im Buch fünfjährig sei und dass sie die Zöpfe des Entwurfs wohl kaum selber flechten würde können, und der Alp-Öhi erst recht keine Zeit dafür hätte. Davon liess sich das Team überzeugen und verpasste Heidi ein moderneres (zeitloses) Outfit.
Nicht ganz so stimmig erscheint mir allerdings die Gesamtwürdigung der Heidi-Verfilmungen. Einerseits wird die 2015er-Version doch sehr hervorgehoben, die Drehbuchautorin Petra Biondina Volpe kommt etwas gar lange zu Wort. Auf der anderen Seite war für die 1952er-Verfilmung wohl eher die knappe Kasse verantwortlich, der Blut-Boden-Geist dürfte beim italienischen Regisseur Luigi Comencini ohnehin kaum gerechtfertigt sein.
Eine etwas zeitlosere (und differenziertere) Gewichtung der Heidi-Verfilmungen hätte dem Werk noch mehr Glanz gegeben. In Bezug auf den Blut-Boden-Geist der 50er-Jahre gibt es bei den beiden Heidi-Filmen aus den 50er-Jahren gweichtige Unterschiede. Im Dok-Film wird die 1952er-Version erwähnt bzw. gezeigt, womit schlicht die «falsche» Version unter den Hammer kommt. Letztlich ist es aber eine Kritik auf hohem Niveau, denn der Film ist sehr gelungen und echt sehenswert (auf playsuisse.ch verfügbar).
2024: Heidi-Glauben und mit Luchs unterwegs
Letztes Jahr entstand abermals eine neue Heidi-Verfilmung. Darin wird Clara nicht kraft der Natur wieder gesund bzw. (er)lernt das Laufen. Vielmehr besorgt dies Gott himself. Immerhin ist die Rollstuhszene einigermassen gelungen.

Gerade aktuell im Kino treibt ein neuer Film sein (Un-)Wesen. Der Film «Heidi – Die Legende vom Luchs» verspricht eine neue Handlung. Da ich den Film nicht gesehen habe, wäre ein (abschliessendes) Urteil nicht wirklich fair. Trotzdem hätte ich da meine Zweifel, der Trailer (in Mundart bei Cinefile.ch) lässt wenig Sinnvolles erahnen.
Oder um hier abschliessend die grosse Frage zu stellen, was gibt der Heidi-Stoff eigentlich her, was anderen Geschichten fehlt? Nach meiner Einschätzung sind es Gegensätze wie Stadt (Urbanität) und Land (Berge), das Verhältnis von Kindern zu Erwachsenen, pure Lebensfreude (Heidi himself) gepaart mit der Krankheit von Clara oder der gute Öhi und die Bösen der Staatsmacht.
Die Luchs-Version spielt (dem Trailer nach) «nur» in den Bergen und selbst der böse Unternehmer, der dem Luchs an den Kragen will (wo bleiben die Jäger?) sieht derart harmlos freundlich aus, dass das Happy-End (kindgerecht) garantiert ist. Oder in vier Worten gesagt: Es fehlt an Gegensätzen! Diese aber bilden die Grundlage für alle Heidi-Stoffe.
Hoffen wir einfach, dass die ebenfalls in diesem Jahr angekündigte neue Serie (Co-Produktion Schweizer Fernsehen und RTL) genügend Spannung (Gegensätze) zimmert. Ob diese allerdings darin besteht, dass Heidi beim Heranwachsen als junge Frau begleitet wird, ich hätte da meine Zweifel.
P.S II. Die Bilder in diesem Beitrag entstammen alle den entsprechenden Heidi-Filmen. Sie werden hier im Sinne des Zitierungsrechtes verwendet. Eine anderweitige Verwendung ist ausgeschlossen. In diesem Sinne dürfen die Bilder auch nicht ab dieser Homepage kopiert werden.
 Zum Inhalt springen
Zum Inhalt springen